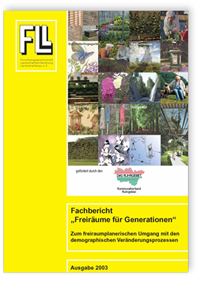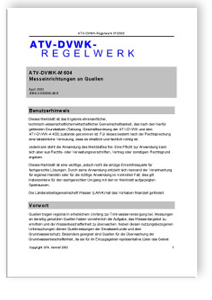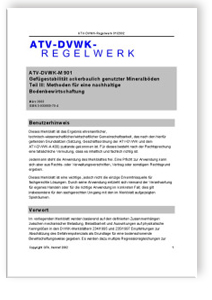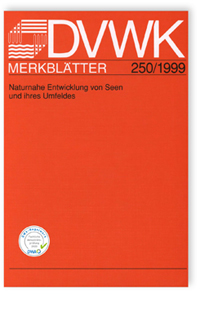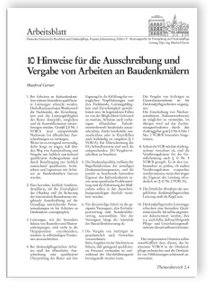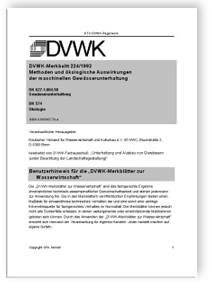Stadtplanung und Raumplanung – ein Überblick
Stadtplanung und Raumplanung beschäftigen sich mit der Entwicklung von Städten sowie mit räumlichen und sozialen Strukturen. Das umfasst beispielsweise die Bereiche Siedlungsentwicklung, Ökonomie, Freizeit und Erholung, Mobilität und Naturschutz.
Definition der Stadtplanung
Die Stadtplanung beschäftigt sich, anders als die Raumplanung, speziell mit der Entwicklung der Stadt sowie mit den räumlichen und sozialen Strukturen im Stadtraum. Davon ausgehend erarbeiten Stadtplaner Konzepte für das Aussehen und die Struktur sowie die Infrastruktur einer Stadt. Dabei werden öffentliche, rechtliche und private Belange beachtet mit dem stetigen Ziel der Konfliktminimierung.
Als Ordner der Bautätigkeit steuert die Stadtplanung im Rahmen der Bauleitplanung die Bodennutzung im Gebiet einer Gemeinde. Sie ist auch für die Infrastrukturentwicklung zuständig. Die Stadtplanung ist stets ein Ausdruck von gesellschaftlichen Prozessen und Bedürfnissen. Im Stadtplanungsamt werden gesetzlich erforderliche Planungsinstrumente wie der Flächennutzungsplan und Bebauungspläne vorbereitet.
Definition der Raumplanung
Die Raumplanung ist ein Überbegriff für alle Maßnahmen, die einen geographischen Raum ordnen und gezielt nutzen. Dabei geht es um bestimmte Verwaltungsgebiete, deren naturräumliche, wirtschaftliche und soziale Möglichkeiten genutzt werden können. In Deutschland lässt sich zwischen räumlicher Gesamtplanung wie etwa der Regional- und Landesplanung oder der gemeindlichen Stadtplanung sowie zwischen sektoraler Fachplanung unterscheiden. Dabei gehört die Stadtplanung als Disziplin der Raumplanung zur Gesamtplanung, während zum Beispiel Verkehrs- und Landschaftsplanung als Sektoren gelten.
Mehr noch als die Stadtplanung stellt sich die Raumplanung große Fragen danach, wie die Welt am besten verändert, genutzt oder geschützt werden kann. Entsprechend ist die Disziplin damit beschäftigt, die unterschiedlichen Anforderungen an Flächen zu analysieren und Konflikte und Chancen abzuwägen.
Rechtlicher Hintergrund
In Deutschland gibt es für die Stadtplanung und die Raumplanung mehrere rechtliche Grundlagen. Jedoch existiert kein rechtlich verbindliches Gesamtkonzept. Insbesondere in der Stadtplanung sind die Zuständigkeiten an verschiedene Ämter und Teilverwaltungen verteilt. Spezielle Stadtplanungsämter gibt es nur in größeren Städten. Neben übergeordneten Landesbehörden, halböffentlichen und privaten Institutionen sind auch politische Gremien und die Bürger (im Rahmen von institutionalisierten Beteiligungsprozessen) wichtige Teilnehmende an der Stadtplanung.
Der Gesetzgeber sieht je nach Größe des zu beplanenden Raums verschiedene Planungsebenen vor. Deren Aufgaben und Maßstäbe sind daher unterschiedlich. Es gilt ein hierarchisches Prinzip, bei dem die untergeordnete Ebene den übergeordneten Plänen und Programmen nicht widersprechen darf. Dies ist die hierarchische Ordnung in absteigender Reihenfolge:
- Bund
- Bundesland
- Regierungsbezirke
- Landkreise oder kreisfreie Städte
- Gemeinden
Auf der Ebene des Bundes gibt es keine formellen gesetzlichen Regelungen zur Raumordnung oder Stadtplanung. Das Raumordnungsgesetz des Bundes gibt lediglich Hinweise zum allgemeinen Vorgehen. Jedoch sind informelle Instrumente vorhanden, die die Raumordnung in Deutschland leiten. Auf der Landesebene gibt es ebenfalls Raumordnungsgesetze und Landesentwicklungsprogramme oder -pläne, die zu beachten sind. In den darauf folgenden Regierungsbezirken oder Kreisen gibt es Regionalpläne. Und auf der kommunalen Ebene folgen Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, die die Raumordnung auf der untersten Ebene steuern. Sie sind die rechtlichen Instrumente mit den meisten Details.
Übrigens: Auch das übergeordnete Planwerk des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes ist in europäischen Ländern zu beachten.
Handlungsfelder von Stadt- und Raumplanung
Die Stadt- und Raumplanung hat die wesentliche Aufgabe, die langfristig gewünschte und mittelfristig zulässige Nutzung von Flächen in Deutschland zu bestimmen. Dabei geht es um Fragen wie »Wo darf gebaut werden?«, »Wer darf hier bauen?« und »Welche Gebiete sollen geschützt werden?«.
Darüber hinaus sind die Disziplinen auch damit befasst, wie sämtliche Bewohner eines Gebietes am besten versorgt werden können. Die Raumplanung gibt Vorgaben zur Bereitstellung von Transport und von technischen Ver- und Entsorgungssystemen sowie zur allgemeinen öffentlichen Infrastruktur, wie Schulen oder Arbeitsämtern, aber auch Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten für z.B. die ältere Generation. Damit werden Flächen erschlossen und in Wert gesetzt. Die Stadtplanung und die kommunale Infrastrukturplanung sind dafür zuständig, auf der lokalen Ebene diese größeren Visionen der Raumplanung umzusetzen.
Außerdem besteht ein wichtiges Handlungsfeld der Raumordnung in Deutschland darin, das Bauen zu kontrollieren und zu steuern. Das geht etwa durch die Festsetzung von Baudichten und Bauweisen. Bauherren müssen sich vor dem Bau darüber informieren, wo gebaut werden darf, was erlaubt ist und welche örtlichen Regelungen beachtet werden müssen. So soll ein verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes Bauen garantiert werden.
Instrumente der Stadtplanung
Dies sind die wichtigen Instrumente, die die Raumordnung allgemein und die Stadtplanung speziell ermöglichen:
- Rechtsvorschriften wie das Baugesetzbuch, die Bauleitplanung, Bau- und Modernisierungsgebote
- Gesetzliche Regelungen für sektorale Planungen wie Verkehrs- und Naturschutz
- Instrumente wie Pläne und Konzepte, die das Verhalten privater Investoren steuern und bei der verwaltungsinternen Koordination helfen
- Stadtentwicklungspläne, sektorale Pläne und Generalverkehrspläne
- Informelle Dokumente wie Stadtteilentwicklungspläne
Darüber hinaus arbeiten sowohl Raumplaner als auch Stadtplaner mit Experten aus anderen Sektoren zusammen, um ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen, was zum Beispiel den Umweltschutz beim Bau angeht. Zunehmend werden Beteiligungsverfahren zu einem wichtigen planerischen Instrument, das den geplanten Maßnahmen mehr Legitimität und Akzeptanz durch die Bevölkerung geben soll.
Ziele der Stadtplanung und Raumplanung
Stadt- und Raumplanung sind intrinsisch mit einer zeitlichen Komponente verbunden, denn sie haben ein bestimmtes Ziel hinsichtlich der Gestalt und Gestaltung von Städten oder übergeordneten Räumen. Sie integrieren viele einzelne Pläne in die Planungen.
Das wichtigste Ziel der Stadtplanung besteht darin, mit den vorhandenen Hilfsmitteln Flächennutzungspläne und Bebauungspläne für ein Stadtgebiet zu erstellen. Neben übergeordneten Plänen müssen dabei die Vorstellungen und Wünsche der Bevölkerung, ökonomische und ökologische Interessen sowie politische Aspekte beachtet werden. Die Stadtplanung vermittelt zwischen Stadtverwaltung und Stadtpolitik und ist zugleich von beiden abhängig, um Gültigkeit für ihre Pläne zu erhalten.
Die Raumordnung hat das übergeordnete Ziel, räumliche Anforderungen auf verschiedenen Ebenen abzustimmen, Konflikte auszugleichen und Vorsorge für die künftige Nutzung des Raums zu treffen. Wie auch in der Stadtplanung wird hier eine nachhaltige Balance aus sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüchen an den Raum angestrebt. Dabei möchte die Raumordnung die natürlichen Lebensgrundlagen schützen, wirtschaftliche Standortvoraussetzungen schaffen oder verbessern, langfristige Gestaltungsmöglichkeiten offenhalten, die Vielfalt von Räumen stärken und gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen.
Erst ein Zusammenspiel aus Stadt- und Raumplanung unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Belangen macht das Wohnen wohnenswert.
Herausforderungen der Stadtplanung
Die Stadtplanung in Deutschland steht vor vielen Herausforderungen. Die Gesellschaft verändert sich, Wohnraum ist knapp und muss neugedacht werden, es gilt die Umwelt zu schützen. Oft fehlen Gelder für die Regionalplanung, weshalb der Städtebau von Geldern des Bundeslandes, des Bundes sowie von privaten Investoren abhängig sein kann. Nur mit ausreichender Finanzierung gelingt es, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu realisieren. Diese sieht für jede Stadt anders aus, da sie unter anderem von den jeweiligen historischen Besonderheiten und aktuellen Herausforderungen abhängt.
Die moderne Stadtplanung sieht sich einer weiteren Herausforderung gegenüber: der feministischen Stadtplanung. Städte müssen sich an die speziellen Bedürfnisse von Frauen anpassen. Denn nach wie vor sind die meisten Stadtplaner Männer, was zu Städten führt, die für Männer gedacht sind. Faktoren wie Straßenbeleuchtung bei Nacht, frauenfreundliche öffentliche Toiletten oder Gemeinschaftsflächen werden dabei nicht immer bedacht, da sie tendenziell für Frauen bedeutsamer sind.
Sehr wichtig ist auch die nachhaltige Stadtplanung, und zwar insbesondere im Hinblick auf die ökologische Komponente: Jede Planung ist heute mit dem Klimaschutz und der Umwelt befasst. So trägt sie dazu bei, Klimaschutzziele mit dem Stadtentwicklungskonzept umzusetzen. Herausforderungen sind auch hier die Finanzierung, aber teils auch die Machbarkeit oder fehlende Datengrundlagen.
Herausforderungen in der Raumplanung
Die Raumplanung steht vor der Herausforderung, dass sie oft in die Natur eingreift, um etwa neue Wohngebiete oder Straßen auf freien Flächen zu errichten. Dies kann für den Umweltschutz von negativer Bedeutung sein. Zudem muss die räumliche Planung darauf achten, Vorhaben mit einem möglichst großen Konsens der Bevölkerung umzusetzen, um Konflikte zu vermeiden.
Wichtige Ziele der Raumordnung in Deutschland, die insbesondere zum Umweltschutz beitragen sollen, sehen wie folgt aus:
- Entwicklung von Projekten und Konzepten nach dem Nachhaltigkeitsgedanken
- Einhaltung fairer Verfahren bei der Umsetzung von Konzepten
- Ressourcenschonende Verfahren bei der Umsetzung und Entwicklung von Konzepten